Universitäre Qualifikation
Die größte Fakultät für Design der Welt"
Präsentation
Dieses Programm bereitet Sie auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Produktdesigns vor, mit einer 100%igen Online-Methode, die sich vollständig an Ihre beruflichen und persönlichen Umstände anpasst”
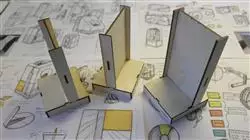
Hinter den Werkzeugen und Geräten, die Millionen von Menschen tagtäglich benutzen, steckt ein enormer Planungs- und Designaufwand. Jeder Aspekt der physischen und greifbaren Elemente, die in allen Lebensbereichen zum Einsatz kommen - von Fahrzeugen über Wohnmöbel und Stadtmobiliar bis hin zu Kugelschreibern, Smartphones und kurzum allen Gegenständen des täglichen Gebrauchs - wurde sorgfältig durchdacht.
Diese Liebe zum Detail beruht auf mehreren starken Argumenten: Mit dem richtigen Design lassen sich Kosten sparen, die Produktion kann effizienter gestaltet werden und das Ergebnis ist aus kommerzieller Sicht attraktiver. Deshalb gewinnt dieser Berufszweig immer mehr an Bedeutung und ist für viele Unternehmen in der Industrie, der Textilbranche und verwandten Bereichen unverzichtbar.
Designer, die sich auf diesen Bereich spezialisieren, können daher heutzutage auf ausgezeichnete Berufsaussichten hoffen, aber um diese zu erreichen, benötigen sie die besten Kenntnisse und Fähigkeiten in dieser Disziplin. Der Private Masterstudiengang in Produktdesign vermittelt diese Kenntnisse und Fähigkeiten, indem er die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich in 10 spezialisierte Module integriert und relevante Themen wie digitale Technologie, Grundlagen des Marketings, Design für die Fertigung und nachhaltiges Design behandelt.
All dies wird über ein Online-Lernsystem vermittelt, das speziell für Berufstätige entwickelt wurde, da es sich an deren Bedürfnisse anpasst und es ihnen ermöglicht, jederzeit und überall zu studieren, ohne unbequeme Reisen oder starre Zeitpläne.
Dank dieses privaten Masterstudiengangs werden Sie in der Lage sein, die wichtigsten Aspekte des nachhaltigen Designs eingehend zu studieren und die Produktion Ihrer Kreationen zu optimieren"
Dieser Privater masterstudiengang in Produktdesign enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt. Die hervorstechendsten Merkmale sind:
- Die Entwicklung von Fallstudien, die von Experten für das Produktdesign vorgestellt werden
- Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt soll wissenschaftliche und praktische Informationen zu den für die berufliche Praxis wesentlichen Disziplinen vermitteln
- Er enthält praktische Übungen, in denen der Selbstbewertungsprozess durchgeführt werden kann, um das Lernen zu verbessern
- Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden
- Theoretische Vorträge, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen Themen und individuelle Reflexionsarbeit
- Die Verfügbarkeit des Zugangs zu Inhalten von jedem festen oder tragbaren Gerät mit Internetanschluss
Dieses Programm verfügt über die besten Lehrmittel: theoretische und praktische Aktivitäten, Videos, interaktive Zusammenfassungen, Meisterklassen usw. Alles, was Sie brauchen, um ein großer Experte für Produktdesign zu werden"
Zu den Dozenten des Programms gehören Fachleute aus der Branche, die ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit in diese Weiterbildung einbringen, sowie anerkannte Spezialisten aus führenden Unternehmen und renommierten Universitäten.
Die multimedialen Inhalte, die mit der neuesten Bildungstechnologie entwickelt wurden, werden der Fachkraft ein situiertes und kontextbezogenes Lernen ermöglichen, d. h. eine simulierte Umgebung, die eine immersive Fortbildung bietet, die auf die Ausführung von realen Situationen ausgerichtet ist.
Das Konzept dieses Programms konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkraft versuchen muss, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Zu diesem Zweck wird sie von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von renommierten Experten entwickelt wurde.
Sie lernen die modernsten Materialien für das Design und deren Anwendungsmöglichkeiten kennen und verbessern so sofort Ihre beruflichen Aussichten"

Das Online-Lernsystem von TECH ermöglicht es Ihnen, zu studieren, wann, wie und wo Sie wollen, ohne an starre Zeitpläne oder unbequeme Reisen gebunden zu sein"
Lehrplan
Dieser Private Masterstudiengang in Produktdesign ist in 10 spezialisierte Module gegliedert, durch die die Fachkräfte die neuesten Fortschritte in den Bereichen Grundlagen des Designs, Designmaterialien, nachhaltiges Design, Grundlagen des Marketings und Corporate Image kennenlernen können. Damit erreichen Sie eine umfassendere Sichtweise des Produkt- und Produktionsdesigns, mit der die Studenten ihre Projekte aus einer eher industriellen Perspektive durchführen können.

Die aktuellsten Inhalte im Bereich Produktdesign sind jetzt in Ihrer Reichweite. Schreiben Sie sich jetzt ein und profitieren Sie von einer sofortigen beruflichen Verbesserung”
Modul 1. Grundlagen des Designs
1.1. Geschichte des Designs
1.1.1. Die industrielle Revolution
1.1.2. Die Phasen des Designs
1.1.3. Die Architektur
1.1.4. Die Chicagoer Schule
1.2. Designstile und Strömungen
1.2.1. Dekoratives Design
1.2.2. Modernistische Strömung
1.2.3. Art Deco
1.2.4. Industriedesign
1.2.5. Das Bauhaus
1.2.6. Industrielles Design
1.2.7. Transvanguardien
1.2.8. Zeitgenössisches Design
1.3. Designer und Trends
1.3.1. Innenarchitekten
1.3.2. Grafikdesigner
1.3.3. Industrie- oder Produktdesigner
1.3.4. Modedesigner
1.4. Projektmethodik im Design
1.4.1. Bruno Munari
1.4.2. Gui Bonsiepe
1.4.3. J. Christopher Jones
1.4.4. L. Bruce Archer
1.4.5. Guillermo González Ruiz
1.4.6. Jorge Frascara
1.4.7. Bernd Löbach
1.4.8. Joan Costa
1.4.9. Norberto Cháves
1.5. Sprache im Design
1.5.1. Objekte und das Subjekt
1.5.2. Semiotik der Objekte
1.5.3. Die objektive Disposition und ihre Konnotation
1.5.4. Die Globalisierung der Zeichen
1.5.5. Vorschlag
1.6. Design und seine ästhetisch-formale Dimension
1.6.1. Visuelle Elemente
1.6.1.1. Die Form
1.6.1.2. Messung
1.6.1.3. Farbe
1.6.1.4. Die Textur
1.6.2. Relationale Elemente
1.6.2.1. Leitung
1.6.2.2. Position
1.6.2.3. Räumlich
1.6.2.4. Schweregrad
1.6.3. Praktische Elemente
1.6.3.1. Vertretung
1.6.3.2. Bedeutung
1.6.3.3. Funktion
1.6.4. Referenzrahmen
1.7. Analytische Methoden des Designs
1.7.1. Pragmatisches Design
1.7.2. Analoges Design
1.7.3. Ikonisches Design
1.7.4. Kanonisches Design
1.7.5. Die wichtigsten Autoren und ihre Methodik
1.8. Design und Semantik
1.8.1. Semantik
1.8.2. Bedeutung
1.8.3. Denotative Bedeutung und konnotative Bedeutung
1.8.4. Lexikon
1.8.5. Lexikalisches Feld und lexikalische Familie
1.8.6. Semantische Beziehungen
1.8.7. Semantische Veränderung
1.8.8. Ursachen für semantische Veränderungen
1.9. Design und Pragmatik
1.9.1. Praktische Konsequenzen, Abduktion und Semiotik
1.9.2. Mediation, Körper und Gefühle
1.9.3. Lernen, Erfahrung und Abschluss
1.9.4. Identität, soziale Beziehungen und Objekte
1.10. Aktueller Designkontext
1.10.1. Aktuelle Designprobleme
1.10.2. Aktuelle Designthemen
1.10.3. Beiträge zur Methodik
Modul 2. Grundlagen der Kreativität
2.1. Einführung in die Kreativität
2.1.1. Stil in der Kunst
2.1.2. Trainieren Sie Ihr Auge
2.1.3. Kann jeder kreativ sein?
2.1.4. Bildhafte Sprachen
2.1.5. Was brauche ich? Materialien
2.2. Wahrnehmung als erster kreativer Akt
2.2.1. Was sehen Sie? Was hören Sie? Was fühlen Sie?
2.2.2. Nimmt wahr, beobachtet, prüft aufmerksam
2.2.3. Das Porträt und das Selbstporträt: Cristina Núñez
2.2.4. Fallstudie: Photodialog. In sich selbst eintauchen
2.3. Das leere Papier vor Augen
2.3.1. Zeichnen ohne Angst
2.3.2. Das Notizbuch als Werkzeug
2.3.3. Das Künstlerbuch, was ist das?
2.3.4. Referenzen
2.4. Erstellung unseres Künstlerbuchs
2.4.1. Analyse und Spiel: Bleistifte und Filzstifte
2.4.2. Tricks zur Lockerung der Hand
2.4.3. Erste Zeilen
2.4.4. Die Feder
2.5. Erstellen unseres Künstlerbuchs II
2.5.1. Der Fleck
2.5.2. Wachse. Experimentieren
2.5.3. Natürliche Pigmente
2.6. Erstellen unseres Künstlerbuchs III
2.6.1. Collage und Fotomontage
2.6.2. Traditionelle Tools
2.6.3. Online-Tools: Pinterest
2.6.4. Experimentieren mit der Bildkomposition
2.7. Tun ohne zu denken
2.7.1. Was erreichen wir, wenn wir handeln, ohne zu denken?
2.7.2. Improvisieren: Henri Michaux
2.7.3. Action Painting
2.8. Der Kritiker als Künstler
2.8.1. Konstruktive Kritik
2.8.2. Manifest zur Kreativkritik
2.9. Der kreative Block
2.9.1. Was ist eine Blockierung?
2.9.2. Erweitern Sie Ihre Grenzen
2.9.3. Fallstudie: Sich die Hände schmutzig machen
2.10. Studium unseres Künstlerbuchs
2.10.1. Emotionen und ihr Management im kreativen Bereich
2.10.2. Ihre eigene Welt in einem Notizbuch
2.10.3. Was habe ich gefühlt? Selbst-Analyse
2.10.4. Fallstudie: Selbstkritik
Modul 3. Digitale Technologie
3.1. Einführung in das digitale Bild
3.1.1. IKT
3.1.2. Beschreibung der Technologie
3.1.3. Befehle
3.2. Vektorielles Bild. Arbeiten mit Objekten
3.2.1. Auswahl-Tools
3.2.2. Clustering
3.2.3. Ausrichten und Verteilen
3.2.4. Intelligente Leitlinien
3.2.5. Symbole
3.2.6. Transformieren
3.2.7. Verzerrung
3.2.8. Verkeidend
3.2.9. Pfadfinder
3.2.10. Zusammengesetzte Formen
3.2.11. Zusammengesetzte Pfade
3.2.12. Schneiden, Teilen und Trennen
3.3. Vektorielles Bild. Farbe
3.3.1. Farb-Modi
3.3.2. Pipettenwerkzeug
3.3.3. Proben
3.3.4. Gradienten
3.3.5. Ausfüllen des Motivs
3.3.6. Erscheinungsbild-Panel
3.3.7. Attribute
3.4. Vektorielles Bild. Erweiterte Ausgabe
3.4.1. Gradient Mesh
3.4.2. Transparenz-Panel
3.4.3. Überblendmodi
3.4.4. Interaktiver Abdruck
3.4.5. Schnittmasken
3.4.6. Text
3.5. Bitmap-Bild. Die Schichten
3.5.1. Erschaffung
3.5.2. Link
3.5.3. Transformation
3.5.4. Clustering
3.5.5. Anpassungsebenen
3.6. Bitmap-Bild. Auswahlen, Masken und Kanäle
3.6.1. Werkzeug zur Rahmenauswahl
3.6.2. Lasso-Auswahlwerkzeug
3.6.3. Zauberstab-Werkzeug
3.6.4. Menü Auswahlen. Farbpalette
3.6.5. Kanäle
3.6.6. Maske retuschieren
3.6.7. Schnittmasken
3.6.8. Vektor-Masken
3.7. Bitmap-Bild. Mischmodi und Ebenenstil
3.7.1. Ebenenstil
3.7.2. Opazität
3.7.3. Optionen für den Ebenenstil
3.7.4. Überblendmodi
3.7.5. Beispiele für Fusionsmodi
3.8. Redaktionelles Projekt. Typen und Formen
3.8.1. Redaktionelles Projekt
3.8.2. Typologien für das redaktionelle Projekt
3.8.3. Erstellung und Konfiguration des Dokuments
3.9. Kompositorische Elemente des redaktionellen Projekts
3.9.1. Master-Seiten
3.9.2. Retikulation
3.9.3. Textintegration und Komposition
3.9.4. Integration von Bildern
3.10. Layout, Export und Druck
3.10.1. Layout
3.10.1.1. Fotoauswahl und -bearbeitung
3.10.1.2. Vorläufige Prüfung
3.10.1.3. Verpackung
3.10.2. Exportieren
3.10.2.1. Export für digitale Medien
3.10.2.2. Export für das physische Medium
3.10.3. Drucken
3.10.3.1. Traditioneller Druck
3.10.3.1.1. Binden
3.10.3.2. Digitaldruck
Modul 4. Grundlagen des Marketings
4.1. Einführung in das Marketing
4.1.1. Konzept des Marketings
4.1.1.1. Definition von Marketing
4.1.1.2. Entwicklung und aktueller Stand des Marketings
4.1.2. Unterschiedliche Ansätze für das Marketing
4.2. Marketing in Unternehmen: strategisch und operativ. Der Marketingplan
4.2.1. Kaufmännisches Management
4.2.2. Bedeutung des kaufmännischen Managements
4.2.3. Vielfältige Formen der Verwaltung
4.2.4. Strategisches Marketing
4.2.5. Kommerzielle Strategie
4.2.6. Anwendungsbereiche
4.2.7. Kommerzielle Planung
4.2.8. Der Marketingplan
4.2.9. Begriffe und Definitionen
4.2.10. Etappen des Marketingplans
4.2.11. Arten von Marketingplänen
4.3. Das Unternehmensumfeld und der Markt für Organisationen
4.3.1. Das Umfeld
4.3.2. Konzepte und Grenzen des Umfelds
4.3.3. Makro-Umfeld
4.3.4. Mikro-Umfeld
4.3.5. Der Markt
4.3.6. Marktkonzepte und Grenzen
4.3.7. Marktentwicklungen
4.3.8. Arten von Märkten
4.3.9. Die Bedeutung des Wettbewerbs
4.4. Verbraucherverhalten
4.4.1. Die Bedeutung von Verhalten in der Strategie
4.4.2. Beeinflussende Faktoren
4.4.3. Vorteile für das Unternehmen
4.4.4. Vorteile für den Verbraucher
4.4.5. Ansätze zum Verbraucherverhalten
4.4.6. Merkmale und Komplexität
4.4.7. Beteiligte Variablen
4.4.8. Verschiedene Arten von Ansätzen
4.5. Etappen im Kaufprozess der Verbraucher
4.5.1. Fokus
4.5.2. Ansatz nach verschiedenen Autoren
4.5.3. Die Entwicklung des Prozesses in der Geschichte
4.5.4. Etappen
4.5.5. Erkennen des Problems
4.5.6. Suche nach Informationen
4.5.7. Bewertung von Alternativen
4.5.8. Kaufentscheidung
4.5.9. Nach dem Kauf
4.5.10. Modelle zur Entscheidungsfindung
4.5.11. Wirtschaftsmodell
4.5.12. Psychologisches Modell
4.5.13. Gemischte Verhaltensmodelle
4.5.14. Marktsegmentierung in der Unternehmensstrategie
4.5.15. Marktsegmentierung
4.5.16. Konzept
4.5.17. Arten der Segmentierung
4.5.18. Der Einfluss der Segmentierung auf die Strategien
4.5.19. Die Bedeutung der Segmentierung im Unternehmen
4.5.20. Planungsstrategien auf der Grundlage von Segmentierung
4.6. Kriterien für die Segmentierung von Verbraucher- und Industriemärkten
4.7. Verfahren zur Segmentierung
4.7.1. Segmentabgrenzung
4.7.2. Identifizierung von Profilen
4.7.3. Bewertung des Verfahrens
4.8. Kriterien für die Segmentierung
4.8.1. Geografische Merkmale
4.8.2. Soziale und wirtschaftliche Merkmale
4.8.3. Andere Kriterien
4.8.4. Reaktion der Verbraucher auf die Segmentierung
4.9. Angebot-Nachfrage-Markt. Bewertung der Segmentierung
4.9.1. Analyse des Angebots
4.9.1.1. Klassifizierungen des Angebots
4.9.1.2. Festlegung des Angebots
4.9.1.3. Faktoren, die das Angebot beeinflussen
4.9.2. Analyse der Nachfrage
4.9.2.1. Klassifizierungen der Nachfrage
4.9.2.2. Marktgebiete
4.9.2.3. Schätzung der Nachfrage
4.9.3. Bewertung der Segmentierung
4.9.3.1. Bewertungssysteme
4.9.3.2. Methoden zur Verfolgung
4.9.3.3. Rückmeldung
4.10. Marketing-Mix
4.10.1. Definition von Marketing-Mix
4.10.1.1. Begriffe und Definitionen
4.10.1.2. Geschichte und Entwicklung
4.10.2. Elemente des Marketing-Mix
4.10.2.1. Produkt
4.10.2.2. Preis
4.10.2.3. Verteilung
4.10.2.4. Werbung
4.10.3. Die 4 neuen P des Marketings
4.10.3.1. Personalisierung
4.10.3.2. Teilnahme
4.10.3.3. Peer to peer
4.10.3.4. Modellierte Vorhersagen
4.10.4. Aktuelle Strategien zur Verwaltung des Produktportfolios. Marketingstrategien für Wachstum und Wettbewerb
4.10.5. Portfolio-Strategien
4.10.5.1. Die BCG-Matrix
4.10.5.2. Die Ansoff-Matrix
4.10.5.3. Die Matrix der Wettbewerbsposition
4.10.6. Strategien
4.10.6.1. Strategie der Segmentierung
4.10.6.2. Strategie der Positionierung
4.10.6.3. Strategie der Loyalität
4.10.6.4. Funktionale Strategie
Modul 5. Corporate Image
5.1. Identität
5.1.1. Die Idee der Identität
5.1.2. Warum wird die Identität gesucht?
5.1.3. Arten von Identität
5.1.4. Digitale Identität
5.2. Corporate Identity
5.2.1. Definition. Warum eine Corporate Identity?
5.2.2. Faktoren, die die Corporate Identity beeinflussen
5.2.3. Komponenten der Corporate Identity
5.2.4. Kommunikation der Identität
5.2.5. Corporate Identity, Branding und Corporate Image
5.3. Corporate Image
5.3.1. Merkmale des Corporate Image
5.3.2. Was ist der Zweck des Corporate Image?
5.3.3. Arten von Corporate Image
5.3.4. Beispiele
5.4. Grundlegende Erkennungsmerkmale
5.4.1. Name oder Naming
5.4.2. Die Logos
5.4.3. Die Monogramme
5.4.4. Die Imagotypen
5.5. Faktoren für die Identitätserinnerung
5.5.1. Originalität
5.5.2. Symbolischer Wert
5.5.3. Trächtigkeit
5.5.4. Wiederholung
5.6. Methodik für den Branding-Prozess
5.6.1. Studie über den Sektor und den Wettbewerb
5.6.2. Briefing, Vorlage
5.6.3. Markenstrategie und Markenpersönlichkeit definieren. Die Werte
5.6.4. Zielpublikum
5.7. Der Kunde
5.7.1. Spüren, wie der Kunde ist
5.7.2. Kundentypologien
5.7.3. Der Ablauf der Sitzung
5.7.4. Wie wichtig es ist, den Kunden zu kennen
5.7.5. Ein Budget festlegen
5.8. Handbuch zur Corporate Identity
5.8.1. Markenaufbau und Anwendungsstandards
5.8.2. Corporate Typografie
5.8.3. Unternehmensfarben
5.8.4. Andere grafische Elemente
5.8.5. Beispiele für Unternehmenshandbücher
5.9. Neugestaltung der Identitäten
5.9.1. Gründe für die Entscheidung, eine Identität neu zu gestalten
5.9.2. Bewältigung einer Änderung der Corporate Identity
5.9.3. Gute Praxis. Visuelle Referenzen
5.9.4. Schlechte Praxis. Visuelle Referenzen
5.10. Projekt zur Markenidentität
5.10.1. Präsentation und Erläuterung des Projekts. Referenzen
5.10.2. Brainstorming. Marktanalyse
5.10.3. Zielpublikum, Markenwert
5.10.4. Erste Ideen und Skizzen. Kreative Techniken
5.10.5. Das Projekt einrichten. Typografien und Farben
5.10.6. Lieferung und Korrektur von Projekten
Modul 6. Design für die Herstellung
6.1. Design für die Herstellung und Verpackung
6.2. Formgebung durch Gießen
6.2.1. Gießen
6.2.2. Injektion
6.3. Formgebung durch Verformung
6.3.1. Plastische Verformung
6.3.2. Stanzen
6.3.3. Schmieden
6.3.4. Extrusion
6.4. Umformung durch Materialverlust
6.4.1. Abrieb
6.4.2. Spanabfuhr
6.5. Wärmebehandlung
6.5.1. Härtung
6.5.2. Temperieren
6.5.3. Glühen
6.5.4. Normalisierung
6.5.5. Thermochemische Behandlungen
6.6. Anwendung von Farben und Beschichtungen
6.6.1. Elektrochemische Behandlungen
6.6.2. Elektrolytische Behandlungen
6.6.3. Farben, Lacke und Firnisse
6.7. Verformung von Polymeren und keramischen Materialien
6.8. Herstellung von Verbundwerkstoffteilen
6.9. Additive Fertigung
6.9.1. Powder Bed Fusion
6.9.2. Direct Energy Deposition
6.9.3. Binder Jetting
6.9.4. Bound Power Extrusion
6.10. Robuste Technik
6.10.1. Taguchi-Methode
6.10.2. Planung von Experimenten
6.10.3. Statistische Prozesskontrolle
Modul 7. Materialien
7.1. Materialeigenschaften
7.1.1. Mechanische Eigenschaften
7.1.2. Elektrische Eigenschaften
7.1.3. Optische Eigenschaften
7.1.4. Magnetische Eigenschaften
7.2. Metallische Materialien I. Eisenhaltig
7.3. Metallische Materialien II. Nichteisenhaltig
7.4. Polymere Materialien
7.4.1. Thermoplastische Kunststoffe
7.4.2. Duroplastische Kunststoffe
7.5. Keramische Materialien
7.6. Zusammengesetzte Materialien
7.7. Biomaterialien
7.8. Nanomaterialien
7.9. Korrosion und Zersetzung von Materialien
7.9.1. Arten von Korrosion
7.9.2. Oxidation von Metallen
7.9.3. Korrosionskontrolle
7.10. Nichtdestruktive Tests
7.10.1. Visuelle Inspektionen und Endoskopie
7.10.2. Ultraschall
7.10.3. Röntgenstrahlen
7.10.4. Foucault (Eddy) Wirbelströme
7.10.5. Magnetische Partikel
7.10.6. Eindringende Flüssigkeiten
7.10.7. Infrarot-Thermografie
Modul 8. Nachhaltiges Design
8.1. Umweltzustand
8.1.1. Ökologischer Kontext
8.1.2. Wahrnehmung der Umwelt
8.1.3. Konsum und Konsumismus
8.2. Nachhaltige Produktion
8.2.1. Ökologischer Fußabdruck
8.2.2. Biokapazität
8.2.3. Ökologisches Defizit
8.3. Nachhaltigkeit und Innovation
8.3.1. Produktionsprozesse
8.3.2. Prozessmanagement
8.3.3. Start der Produktion
8.3.4. Produktivität durch Design
8.4. Einleitung. Ökodesign
8.4.1. Nachhaltiges Wachstum
8.4.2. Industrielle Ökologie
8.4.3. Ökoeffizienz
8.4.4. Einführung in das Konzept des Ecodesigns
8.5. Ökodesign-Methoden
8.5.1. Methodische Vorschläge für die Umsetzung des Ökodesigns
8.5.2. Projektvorbereitung (treibende Kräfte)
8.5.3. Umweltaspekte
8.6. Lebenszyklusbewertung (LCA)
8.6.1. Funktionelle Einheit
8.6.2. Bestandsaufnahme
8.6.3. Liste der Auswirkungen
8.6.4. Erstellung von Schlussfolgerungen und Strategie
8.7. Ideen für Verbesserungen (Ecodesign-Strategien)
8.7.1. Reduzierung der Auswirkungen
8.7.2. Erhöhung der funktionalen Einheit
8.7.3. Positive Auswirkungen
8.8. Kreislaufwirtschaft
8.8.1. Definition
8.8.2. Entwicklung
8.8.3. Erfolgsgeschichten
8.9. Cradle to Cradle
8.9.1. Definition
8.9.2. Entwicklung
8.9.3. Erfolgsgeschichten
8.10. Umweltvorschriften
8.10.1. Warum brauchen wir eine Regulierung?
8.10.2. Wer macht die Vorschriften?
8.10.3. Der Umweltrahmen der Europäischen Union
8.10.4. Regulierung im Entwicklungsprozess
Modul 9. Materialien für das Design
9.1. Material als Inspiration
9.1.1. Suche nach Materialien
9.1.2. Klassifizierung
9.1.3. Das Material und sein Kontext
9.2. Materialien für das Design
9.2.1. Häufige Verwendungen
9.2.2. Kontraindikationen
9.2.3. Kombination von Materialien
9.3. Kunst + Innovation
9.3.1. Materialien in der Kunst
9.3.2. Neue Materialien
9.3.3. Zusammengesetzte Materialien
9.4. Physik
9.4.1. Grundlegende Konzepte
9.4.2. Zusammensetzung der Materialien
9.4.3. Mechanische Tests
9.5. Technologie
9.5.1. Intelligente Materialien
9.5.2. Dynamische Materialien
9.5.3. Die Zukunft der Materialien
9.6. Nachhaltigkeit
9.6.1. Beschaffung
9.6.2. Nutzung
9.6.3. Endgültige Verwaltung
9.7. Biomimikry
9.7.1. Reflexion
9.7.2. Transparenz
9.7.3. Andere Techniken
9.8. Innovation
9.8.1. Erfolgsgeschichten
9.8.2. Materialforschung
9.8.3. Quellen der Forschung
9.9. Risikoprävention
9.9.1. Sicherheitsfaktor
9.9.2. Feuer
9.9.3. Bruch
9.9.4. Andere Risiken
Modul 10. Packaging-Design
10.1. Einführung in das Packaging
10.1.1. Historische Perspektive
10.1.2. Funktionelle Merkmale
10.1.3. System-Produkt und Lebenszyklusbeschreibung
10.2. Forschung im Packaging
10.2.1. Informationsquellen
10.2.2. Arbeit vor Ort
10.2.3. Vergleiche und Strategien
10.3. Strukturelles Packaging
10.3.1. Analyse der spezifischen Bedürfnisse
10.3.2. Form, Farbe, Geruch, Volumen und Texturen
10.3.3. Ergonomie der Verpackung
10.4. Vermarktung des Packaging
10.4.1. Beziehung zwischen dem Packaging und der Marke und dem Produkt
10.4.2. Anwendung des Markenimages
10.4.3. Beispiele
10.5. Kommunikation im Packaging
10.5.1. Beziehung zwischen dem Packaging und dem Produkt, dem Kunden und dem Benutzer
10.5.2. Gestaltung der Sinnesorgane
10.5.3. Design von Erfahrungen
10.6. Materialien und Produktionsprozesse
10.6.1. Glas
10.6.2. Papier und Karton
10.6.3. Metall
10.6.4. Kunststoffe
10.6.5. Verbundwerkstoffe aus natürlichen Materialien
10.7. Nachhaltigkeit im Packaging
10.7.1. Ökodesign-Strategien
10.7.2. Lebenszyklus-Analyse
10.7.3. Das Packaging als Abfall
10.8. Gesetzgebung
10.8.1. Besondere Rechtsvorschriften: Identifizierung und Kodierung
10.8.2. Regulierung von Kunststoffen
10.8.3. Trends in der Regulierung
10.9. Innovation im Packaging
10.9.1. Differenzierung durch Packaging
10.9.2. Neueste Trends
10.9.3. Design for All
10.10. Packaging-Projekte
10.10.1. Fallstudien
10.10.2. Packaging-Strategie
10.10.3. Praktische Übung

Das innovative Lehrsystem von TECH wird mit einem vollständigen und aktualisierten Lehrplan kombiniert und ist damit die beste Weiterbildungsmöglichkeit für Berufstätige, die ihre Karriere auf Produktdesign ausrichten möchten”
Privater Masterstudiengang in Produktdesign
Im Zeitalter von Innovation und Kreativität spielt das Produktdesign eine grundlegende Rolle für den Erfolg eines jeden Unternehmens. An der TECH Technologischen Universität bieten wir Ihnen die Möglichkeit, durch unseren Masterstudiengang in Produktdesign ein Experte auf dem Gebiet des Produktdesigns zu werden.
Unsere Online-Kurse ermöglichen es Ihnen, die notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse bequem von zu Hause aus oder von einem beliebigen Ort aus zu erwerben. Sie werden von renommierten Fachleuten aus der Designbranche lernen, die ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen und Sie bei der Entwicklung kreativer und technischer Fähigkeiten anleiten werden.
Der Masterstudiengang in Produktdesign an der TECH Technologischen Universität soll Ihre Kreativität fördern, Ihnen helfen, die Bedürfnisse des Marktes zu verstehen und Ihre Ideen in innovative und funktionale Produkte umzusetzen. Sie lernen den Umgang mit modernsten Design-Tools und -Software sowie die Analyse von Trends und die Durchführung von Marktforschung, um Produkte zu entwickeln, die sich von anderen abheben und den Anforderungen der Verbraucher entsprechen.
Mit unserem Masterstudiengang in Produktdesign verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil am Arbeitsplatz, denn Sie sind auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Produktdesigns vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Ihren Studienplan flexibel an Ihre persönlichen und beruflichen Verpflichtungen anpassen, so dass Sie Ihre Karriere ohne Unterbrechung vorantreiben können.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, ein außergewöhnlicher Produktdesigner zu werden. Schreiben Sie sich für den Masterstudiengang in Produktdesign an der TECH Technologischen Universität ein und lassen Sie sich von Ihrer Leidenschaft für Kreativität und Innovation leiten!







